Bildungsbericht 2022: Qualität des Distanzunterrichts mit "enormer Spannweite"
Fehlende Infrastruktur setzte auch engagierten Menschen während Distanzlernphasen Grenzen. Lehrkräfte suchten Wege, ein Digitalisierungsschub blieb eher aus.
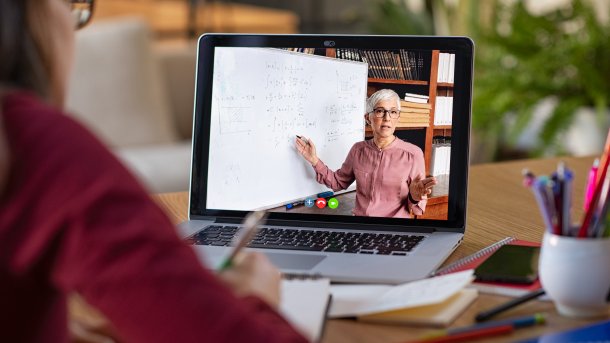
(Bild: Shutterstock.com)
Trotz großer Bemühungen einiger Lehrkräfte und Schulen in den ersten pandemiebedingten Lockdowns Unterricht auch online zu ermöglichen, blieb laut dem nationalen Bildungsbericht 2022 der große Digitalisierungsschub am Anfang der Coronavirus-Pandemie eher aus. Die Qualität des angebotenen Distanzunterrichts sei überdies schwer festzustellen, hatte aber aufgrund der vorher eher geringen Bedeutung von digitalen Kompetenzen unter den Lehrkräften vermutlich "eine enorme Spannweite".
Die Pandemie habe die Schulen weitgehend unvorbereitet getroffen, heißt es in dem Kapitel "Organisation des Schulbetriebs unter Pandemiebedingungen". Demnach mussten alternative Formen der Beschulung organisiert werden, die insbesondere Familien vor große Herausforderungen stellten. Sie mussten Lehrkräfte stärker unterstützen und mussten gleichzeitig viel Planungsunsicherheit verkraften.
Konnte der übliche Präsenzunterricht aus Infektionsschutzgründen oder einem zu hohen Krankenstand nicht fortgesetzt werden, wurden teils recht unterschiedliche Wechselmodelle in den Schulen etabliert. Es gab aber auch Phasen des vollständigen Distanzunterrichts fast aller Klassen. Die Qualität dieses Distanzunterrichts kann laut Bildungsbericht nur schwer ermittelt werden, da es hier an Daten fehle.
Keine großen Kraftakte vor dem Winter 2020
Befragte Lehrkräfte erklärten aber unter anderem, wie es um die Infrastruktur ihrer Schulen bestellt war. Im April 2020, während des ersten Lockdowns, gaben nur 33 Prozent der Lehrkräfte an, dass ihre Schulen "(sehr) gut mit digitalen Hilfsmitteln auf den Distanzunterricht vorbereitet waren". Dies änderte sich auch bis zum zweiten Lockdown im Dezember 2020 kaum. Nur 38 Prozent der Befragten berichteten von einer "(sehr) guten Ausstattung" an ihrer Schule.
Auch fehlte es den Schulen in der Mehrzahl an Gesamtkonzepten für Lernangebote. Während des ersten Lockdowns verfügte hierüber nur ein Drittel aller Schulen. 41 Prozent der Lehrkräfte konnten sich zumindest auf Absprachen und Koordination berufen, 24 Prozent der Befragten arbeiteten ohne abgesprochenes Konzept oder gemeinsame Absprachen.
Zugang zu Arbeitsmaterial und Kontakt zu Lehrkräften
Die Kommunikation zwischen Lehrkräften und Schülerschaft verlief in Lockdown- oder Wechselunterrichtphasen recht unterschiedlich. Digital wurden Unterrichtsmaterialien vor allem per E-Mail verschickt (69 Prozent), über digitale Lern- und Arbeitsplattformen verschickten 41 Prozent der Lehrkräfte Material.
Allerdings unterschieden sich "die Möglichkeiten und Modalitäten, wie den Schüler:innen und Eltern auf Distanz Lernmaterialien bereitgestellt und Kommunikationskanäle eröffnet werden konnten" teils erheblich. Lehrkräfte an Grundschulen stellten vor allem Lernmaterial auf Papier zur Verfügung (57 Prozent), das per Post verschickt wurde oder abgeholt werden konnte. Lehrkräfte an Gymnasien (64 Prozent) und an nichtgymnasialen Sekundarschulen (49 Prozent) machten "stärker von digitalen Arbeits- und Lernplattformen Gebrauch". Dieser Unterschied erkläre sich aber auch durch die Reife und den Lernstatus der Kinder. Grundschüler brauchen generell häufiger Eltern als Helferinnen und Helfer, um den Austausch mit den Lehrkräften überhaupt zu ermöglichen.
(Bild: Bildung in Deutschland 2022)
Erreicht wurden beileibe nicht alle Kinder. Regelmäßig in Kontakt standen befragte Lehrkräfte zu 60 Prozent mit "mehr als der Hälfte oder fast allen Schüler:innen während der ersten Schulschließungen". Den engsten Kontakt sollen ältere Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I und II mit Gymnasiallehrkräften gepflegt haben – "wobei auch hier nicht einmal die Hälfte der Lehrkräfte regelmäßigen Kontakt zu fast allen Schüler:innen unterhielt (43 Prozent)". In den Grundschulen hatten laut Bericht "lediglich 33 Prozent der Lehrkräfte regelmäßigen Kontakt zu fast allen Lernenden".
Wie der Bildungsbericht angibt, könnten aufgrund des fehlenden Kontakts insbesondere bei den jüngeren Kindern "soziale Disparitäten" verschärft worden sein. Auch sei die im pandemischen Kontext zu beobachtende "Zunahme familialer Belastungssituationen" und das gleichzeitige Fehlen regelmäßiger Kontakte besonders problematisch. Allerdings ließen sich "mit den verfügbaren Daten" solche "Konsequenzen der Umstände des Distanzunterrichts jedoch nicht abschließend beurteilen."
Komplette Schulschließungen eher kurz
Auch wirft der Bildungsbericht einen Blick auf tatsächliche, komplette Schulschließungen und Unterrichtsmodelle, die mit Alternativangeboten wie etwa Distanzunterricht statt eines vollständigen Präsenzunterrichtes arbeiteten.
Die erste flächendeckende Einstellung des Präsenzunterrichts an Schulen erfolgte am 16. März 2020. Ab Mitte April 2020 kam es wieder "zur (eingeschränkten) Öffnung des Präsenzunterrichts mit Priorität auf den Abschlussklassen". Bis zum Ende des Jahres 2020 soll dann meist Präsenzunterricht angeboten worden sein und nur weniger als 20 Prozent der Schulen arbeiteten laut Bericht mit anderen Modellen.
(Bild: Bildung in Deutschland 2022)
Die wesentlich größere Einschränkung des Präsenzunterrichts erfolgte mit Beginn des zweiten Lockdowns im Dezember 2020. Anschließend kehrte man weniger schnell zum vorherigen Präsenzunterricht zurück, sondern bis Ende Mai 2021 wurde "fast ausschließlich mit eingeschränktem Präsenzunterricht oder komplett auf Distanz unterrichtet". Erst in den Wochen vor den Sommerferien gingen die Schulen wieder vermehrt in den Präsenzunterricht über.
Wie der Bericht feststellt, war diese Situation "insbesondere für berufstätige Eltern kaum planbar und wenig übersichtlich – auch deshalb, weil je nach Land und nach Schulart unterschiedliche Regelungen getroffen wurden."
Schuljahr 2021/2022 – Zwar Präsenzunterricht, aber viele erkrankt
In Hinblick auf das Schuljahr 2021/2022 erklärt der Bericht, dass zwar nahezu flächendeckend wieder Präsenzunterricht möglich wurde – auch durch die Impfungen – , allerdings konnte "ein nicht unerheblicher Anteil der Schüler:innen und Lehrkräfte aufgrund von Corona-Infektionen oder Quarantäneregelungen [an diesem Präsenzunterricht] nicht teilnehmen". Im Jahr 2022 seien dies je nach Kalenderwoche deutschlandweit zwischen 2 und 6 Prozent aller Kinder und Jugendlichen, in manchen Ländern sogar bis zu 20 Prozent gewesen. Unter den Lehrkräften waren pandemiebedingte Ausfälle zwar etwas geringer (bis zu 13 Prozent), jedoch betreffe dies einen wesentlich größeren Teil der Schülerschaft.
Der Bildungsbericht 2022 ist ein von Bund und Ländern geförderter Bericht, der unter anderem aktuelle Studienergebnisse zusammenfasst. Er erscheint alle zwei Jahre.
Maßnahmen für das kommende Schuljahr noch nicht klar
Die Kultusministerkonferenz der Länder will Ende Juli darüber entscheiden, wie Maßnahmen für das kommende Schuljahr 2022/2023 aussehen könnten. Sie will sich dabei auf die Ergebnisse mehrerer wissenschaftlicher und politischer Gremien stützen, welche die Wirksamkeit vergangener Infektionsschutz-Maßnahmen evaluieren und daraufhin Empfehlungen aussprechen wollen. Die KMK machte aber schon klar, dass die Priorität auf dem Fortsetzen des Präsenzunterrichts liege.
(kbe)