Staatstrojaner-Gesetz: Nächster Halt Bundesverfassungsgericht
Datenschützer, IT-Sicherheitsexperten und Anwälte kritisieren die neuen Kompetenzen von Strafverfolgern für den Einsatz von Spionagesoftware auf Smartphones und Computer scharf. Erste Klagen in Karlsruhe sind in der Mache.
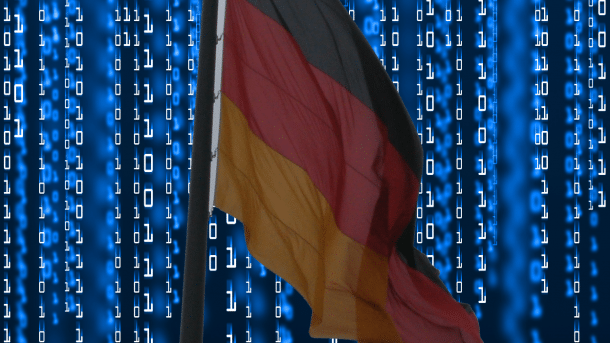
Der umstrittene Beschluss des Bundestags, umfassende Rechtsgrundlagen für die Quellen-Telekommunikationsüberwachung (Quellen-TKÜ) sowie die heimliche Online-Durchsuchung in der Strafprozessordnung zu schaffen und damit der Polizei Staatstrojaner als alltägliches Ermittlungswerkzeug in die Hand zu drücken, dürfte bald vor dem Bundesverfassungsgericht landen. "Die umfangreichen Kataloge zum Einsatz des 'Bundestrojaners' widersprechen den verfassungsrechtlichen Vorgaben", erklärte der frühere Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar gegenüber der Dumont-Mediengruppe. Er halte Beschwerden gegen die Initiative in Karlsruhe daher für aussichtsreich.
Laut Schaar bringt das "WhatsApp-Gesetz" auch Gefahren für die IT-Sicherheit mit sich. "Behörden nutzen genau dieselben IT-Schwachstellen wie Betrüger und Erpresser", monierte der Experte. Der Staat werde so kein Interesse mehr daran haben, solche Lücken zu beseitigen. Der großen Koalition hielt der Vorsitzende der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz vor, fast jede Woche neue Gesetze zu verabschieden, "die die Privatsphäre beeinträchtigen und Bürgerrechte einschränken". Dabei werde weder abgewogen noch Maß gehalten. Dies sei ein "ziemlich arroganter Umgang mit der Macht zulasten der Demokratie und des Rechtsstaats".
Größer als der "große Lauschangriff"
"Mit der Ausweitung staatlicher Befugnisse zur heimlichen Infiltration informationstechnischer Systeme im Hauruckverfahren kehrt der Gesetzgeber die verfassungsrechtlichen und technischen Probleme, mit denen derartige Maßnahmen behaftet sind, unter den Tisch", konstatierte auch die Berliner Datenschutzbeauftragte Maja Smoltczyk. "Dies ist angesichts der schweren Grundrechtseingriffe, die die Maßnahmen mit sich bringen, sehr bedenklich."
Nach Ansicht des Deutschen Anwaltvereins (DAV) dürfte der verabschiedete an Eingriffstiefe und Konsequenzen den "großen Lauschangriff" deutlich überbieten. Daher sei schon das gewählte Verfahren eines nachträglich eingebrachten Änderungsantrags verfassungsrechtlich äußerst gefährlich. Der grüne Fraktionsvize Konstantin von Notz beklagte, dass Schwarz-Rot kurz vor Ende der Legislaturperiode den "finalen Angriff auf die Bürgerrechte" gestartet habe. Sicherheitsbehörden würden damit zu "Chef-Hackern der Republik gemacht", während der Koalition parallel "die Vorratsdatenspeicherung um die Ohren fliegt".
Zero-Days für den Staatstrojaner
"Es ist nicht zu ertragen, dass der deutsche Gesetzgeber regelmäßig die verfassungsrechtlichen Grenzen ausdehnt und Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts schlichtweg ignoriert", hieb der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Wolfgang Kubicki in die gleiche Kerbe. SPD und CDU schienen sich beim Thema Überwachung kontra Cybersicherheit immer weiter überbieten zu müssen. Dabei ließen sie die grundrechtlichen Folgen der Gesetzesvorlagen außer acht. Die bereits im Bereich anderer Sicherheitsgesetze aktive Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) kündigte derweil als erste Organisation an, eine Verfassungsbeschwerde gegen das Vorhaben zu prüfen.
Das Überwachungsgesetz könne "zu einer schädlichen Schwächung der IT-Sicherheit im Internet, wenn nicht gar zu einer Gefährdung der Digitalisierungsprozesse in Gesellschaft und Wirtschaft führen", befürchtet Norbert Pohlmann, Vorstandsmitglied beim eco-Verband der Internetwirtschaft. Dies gelte insbesondere, wenn sich Fahnder "sogenannter Zero-Day-Exploits zur Platzierung der Staatstrojaner" bedienten. Solche Sicherheitslücken auszunutzen bedeute ein großes Risiko sowohl für Unternehmen als auch für die Privatsphäre des Einzelnen. Ein derartiges Verfahren dürfe nicht zur gängigen Praxis in der Strafverfolgung werden. Ob die Initiative verfassungsmäßig sei, "werden die Gerichte entscheiden müssen".
Richterbund ist dafür
Der Deutsche Richterbund (DRB) brach dagegen eine Lanze für den Entwurf. "Es kann nicht sein, dass die Ermittler bei einem Verdacht auf gravierende Straftaten zwar Telefongespräche abhören oder E-Mails mitlesen dürfen, aber nicht auf die Kommunikation bei WhatsApp, Telegram oder Threema zugreifen können", unterstrich dessen Geschäftsführer Sven Rebehn gegenüber der Funke-Mediengruppe. Es sei wichtig, dass der Gesetzgeber die Strafverfolgungsbehörden bei der Überwachung von Telekommunikation wieder auf die Höhe der Zeit bringe. (axk)